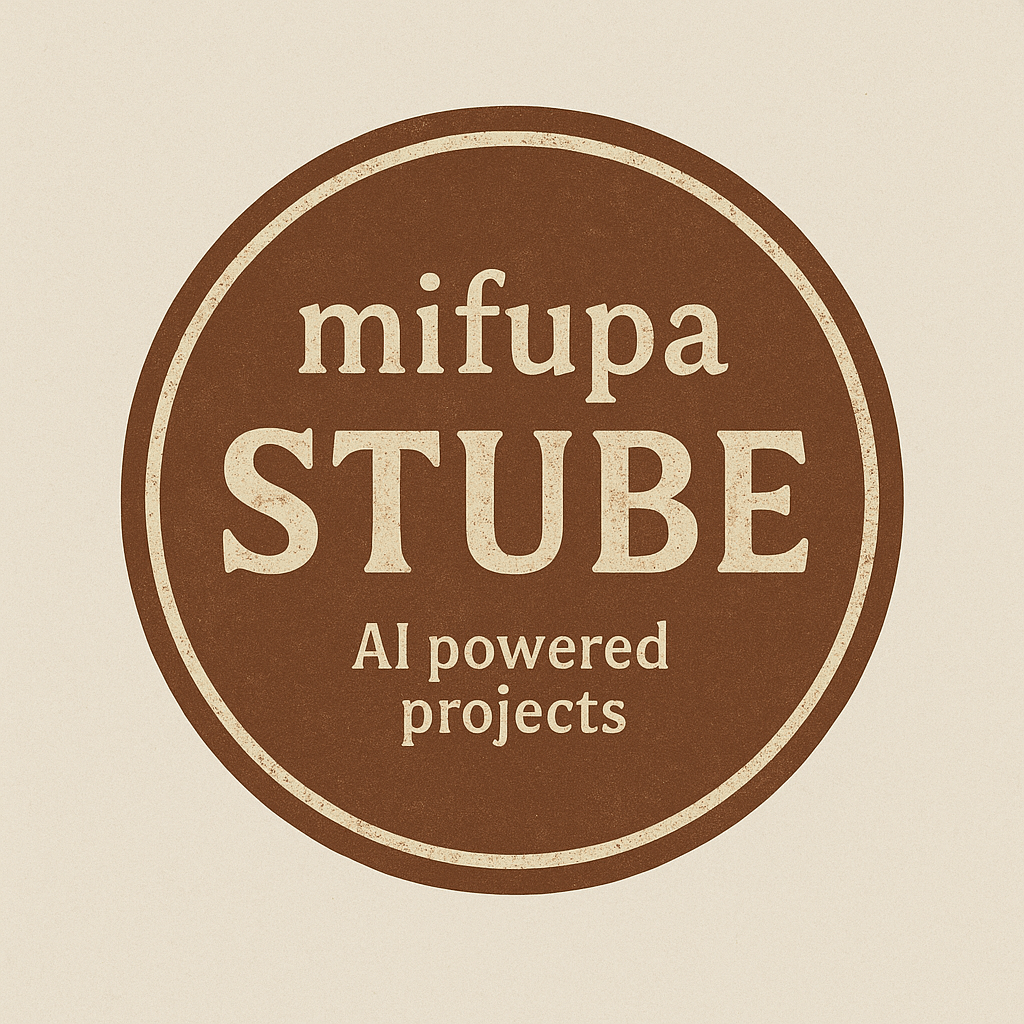Erklärung:
„Arbat“ is die bayerische Version vom hochdeutschen „Arbeit“. Des Wort is kurz, hart und ohne Umweg – wia’s halt im Dialekt üblich is. Es steht ned nur fürs Schuften im Betrieb, sondern aa fürs tägliche Werk dahoam, sei’s im Garten, im Stall oder beim Schneeschaufeln. In Bayern hat „Arbat“ an ambivalenten Klang: Auf da einen Seitn Pflicht und Plag, auf da andern Seitn aa a Grund, sich nach Feierabend a Hoibe zu genehmigen.
Bedeutung
-
Deutsch: Arbeit, Tätigkeit, Mühe
-
Englisch: work, labour, job
Aussprache
-
IPA: [ˈaʁbaːt]
-
Umschrift: „Ar-baat“ (das „t“ knackig ausgsprocha)
Herkunft / Kulturhintergrund
Das Wort kummt wia im Hochdeutschen vom althochdeutschen „arabeit“, wos ursprünglich „Mühsal, Not“ bedeutet hod. Im Bairischen is’s nie die g’feierte „Karriere“, sondern schlicht „Arbat“. Kulturhistorisch is in Bayern a tiefer Respekt vor ehrlicher, körperlicher Arbeit da – ob Bauer, Handwerker oder Maurer. Gleichzeitig schimpft ma gern drüber, weil „Arbat“ halt selten Vergnügen is. Drum is der Spruch „Ohne Arbat koa Hoibe“ fast a Lebensweisheit.
Typische Verwendung (Beispiele)
-
„I muass morgn in d’Arbat, drum sauf i heid nimma z’vui.“
→ Hochdeutsch: „Ich muss morgen zur Arbeit, deshalb trinke ich heute nicht mehr so viel.“ -
„Des is a harte Arbat, aber irgendwer muass es macha.“
→ Hochdeutsch: „Das ist eine harte Arbeit, aber irgendjemand muss sie machen.“
Grantler-Kommentar
Na, Arbat – a Freud is’s selten. I sog’s ehrlich: die meiste Arbat war eigentlich scho g’scheiter erfunden, um de Leut zu beschäftigen, ned weil’s wen gfreit. Am End kummt’s eh aufs Gleiche raus: Der eine schwitzt am Bau, der andere schwitzt im Büro. Bloß der eine hod a g’sunde Hautfarb, der andere an krummen Buckel. Aber guad, ohne Arbat ko ma aa ned, sonst fehlt da Grund für’n Feierabend.
Verwandte Wörter
-
Schuften
-
Maloche
-
Oabeit (andere Schreibweise)
-
Plagerei